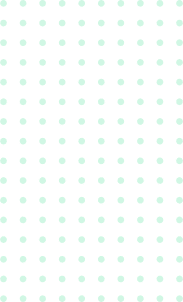Fortbildungen
Die Fortbildungen, die ich absolviere, bieten mir die Möglichkeit, meine Kenntnisse zu vertiefen und neue Fähigkeiten zu erwerben. Ich lege großen Wert auf praxisorientiertes Lernen und die Anwendung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Egal ob es um Notfallmedizin, Pädagogik, Management oder Hygiene geht – meine Fortbildungen sind darauf ausgerichtet, mir die bestmögliche Weiterbildung zu bieten. Entdecken Sie mein umfangreiches Fortbildungsangebot und investieren Sie in Ihre berufliche Zukunft.
- All Cases
- Online
- Präsenz
- Geräteeinweisungen
- Webinar
How to: einen wissenschaftlichen Artikel richtig lesen
Kriterien zur Einordnung der Aussagekraft wissenschaftlicher Artikel werden vorgestellt. Der Fokus liegt auf Forschungsdesign und Methodik, die anhand der klassischen Studie zur prähospitalen Volumentherapie bei Schwerverletzten mit penetrierenden Torsoverletzungen von Bickell et al. (1994) erläutert werden. Ein sorgfältig durchdachtes Forschungsdesign entscheidet über den Erfolg einer wissenschaftlichen Studie und wird vorab im Studienprotokoll festgehalten. Eine Hypothese ist eine vorläufige Erklärung oder Vorhersage und muss test-, falsifizierbar, präzise und relevant sein. Es gibt verschiedene Randomisierungsarten. Die randomisierte kontrollierte Studie ist der Goldstandard klinischer Interventionsstudien. Beim Lesen einer wissenschaftlichen Arbeit sollte kontrolliert werden, ob Forschungsdesign und -setting zur Forschungsfrage passen, und ob Fehlerquellen bedacht und kontrolliert wurden. Kritisch prüfen lassen sich auch Literaturangaben, Finanzierung und Expertise der Forschenden.
verfasst von: Dr. med. Dr. rer. medic. Katharina Fetz, M.Sc.-Psych., Johanna Rutetzki, Rolf Lefering
Transfusionsmedizin
Rechtliche Grundlagen der Transfusionsmedizin
• Indikationsstellung zur Transfusion
• Blutentnahme und Anforderung von Blutprodukten
• Abruf, Transport und Lagerung
• Bedsidetest und Transfusion
• Beenden der Transfusion und Dokumentation
• Transfusionsreaktion: Wenn unerwünschte Folgen auftreten
(2023-06-03)
Intensivtransport | CME-Kurs Interhospitaler Intensivtransport
Kritisch kranke Patienten, die spezialisierte diagnostische oder therapeutische Verfahren benötigen, jedoch in einem Krankenhaus ohne diesbezügliche Ausstattung versorgt werden, müssen unter Fortführung intensivmedizinischer Maßnahmen zu geeigneten Zentren transportiert werden. Solche Transporte sind herausfordernde Einsätze mit hohem Ressourcenbedarf und logistischem Aufwand, die durch ein spezialisiertes Team bewältigt werden müssen. Hierzu ist neben einem effizienten Crew Resource Management eine gute Planung des Einsatzes notwendig. Bei adäquater Vorbereitung sind solche Einsätze für den Patienten sicher und komplikationsarm durchführbar. Neben Routineintensivtransporten gibt es Sondereinsätze (z. B. isolationspflichtiger Patienten oder Patienten mit extrakorporaler Organunterstützung), die eine Anpassung des Teams oder des vorgehaltenen Materials erfordern. Dieser Beitrag beschreibt die Grundlagen des interhospitalen Intensivtransportes, seine Phasen und Sonderfälle.
verfasst von: Maximilian Feth, Carsten Zeiner, Guy Danziger, Christine Eimer, Sebastian Mang, Stefan Kühn, Nick Villalobos, Ralf M. Muellenbach, Sabrina I. Hörsch, Prof. Dr. med. Philipp M. Lepper Zeitschrift: Notfall + Rettungsmedizin | Ausgabe 3/2023
ECMO | CME-Kurs „Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation“ – derzeitiger Stand und Indikationen
Unter extrakorporaler kardiopulmonaler Reanimation (eCPR) versteht man den Einsatz der venoarteriellen extrakorporalen Membranoxygenierung (va-ECMO) unter laufender kardiopulmonaler Reanimation (CPR). Die internationalen Leitlinien empfehlen diese Therapie aktuell bei selektierten Patienten, bei denen die konventionelle CPR versagt hat. Vor allem folgende Kriterien sollten erfüllt sein: beobachtetes Ereignis mit unmittelbarem Beginn der CPR, Möglichkeit des Beginns der eCPR in einem Zeitfenster von 60 min, Patientenalter unter 75 Jahren, Patient ohne limitierende Erkrankungen und bekannter oder hochgradiger Verdacht auf eine behandelbare Ursache. Der Aufbau eines eCPR-Programms erfordert einen hohen Einsatz von Ressourcen mit Etablierung eines Algorithmus, einschließlich klarer Selektionskriterien. Alle Mitglieder des Teams sollen in einem Konsensus der Etablierung dieser invasiven Therapie zustimmen.
verfasst von: PD Dr. med. Christoph Sinning, Dr. med. Elvin Zengin-Sahm, PD Dr. med. Janine Pöss Zeitschrift: Notfall + Rettungsmedizin | Ausgabe 2/2023
Rapid sequence induction | CME-Kurs Präklinische Notfallnarkose beim Erwachsenen
Die Häufigkeit von präklinischen Notfallnarkosen beträgt in Deutschland ca. 2–3 % aller Notarzteinsätze. Für die Durchführung einer präklinischen Notfallnarkose existiert eine durch die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) koordinierte Leitlinie. In diesem Beitrag werden wichtige Aspekte dieser Leitlinie behandelt sowie die Durchführung und Besonderheiten spezifischer Patientengruppen dargestellt. Anhand eines Fallbeispiels wird verdeutlicht, dass das präklinische Setting verschiedene Facetten, die eine ausreichende Erfahrung und Expertise unabdingbar machen, bieten kann. Es wird hervorgehoben, dass nicht immer eindeutige Standardsituationen vorliegen und im präklinischen Setting einige Herausforderungen bestehen. Daher sind das Beherrschen der Inhalte zur präklinischen Notfallnarkose sowie die manuellen Fertigkeiten der Narkoseeinleitung für das Notfallteam essenziell und obligat.
verfasst von: Dr. med. Martin Breitkopf, Dr. med. Christoph Wihler, Prof. Dr. Andreas Walther Zeitschrift: Notfall + Rettungsmedizin | Ausgabe 1/2023
Praxisrelevante Urteile | CME-Kurs Arzthaftung und Strafrecht in der Akutmedizin
Arzthaftung hat Hochkonjunktur. Behandlungsfehler können sowohl zivil- als auch strafrechtlich sanktioniert werden. Neben Geld- und Freiheitsstrafen können Ärzte auch mit approbationsrechtlichen Sanktionen belegt werden. Der Arzt schuldet dem Patient den zum Zeitpunkt der Behandlung anerkannten Standard. Zudem muss er der gebotenen Sorgfaltspflicht nachkommen. Dabei ist das Selbstbestimmungsrecht des Patienten unbedingt zu achten. Insbesondere in Akutsituationen kann es jedoch geboten sein, Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren für die Gesundheit des Patienten in die Wege zu leiten. Im vorliegenden Beitrag werden häufige Fallstricke in der akutmedizinischen Behandlung und ihre juristische Relevanz analysiert.
verfasst von: Dr. Christina Schumann, Dr. jur. Stephanie Wiege Zeitschrift: Notfall + Rettungsmedizin | Ausgabe 7/2022